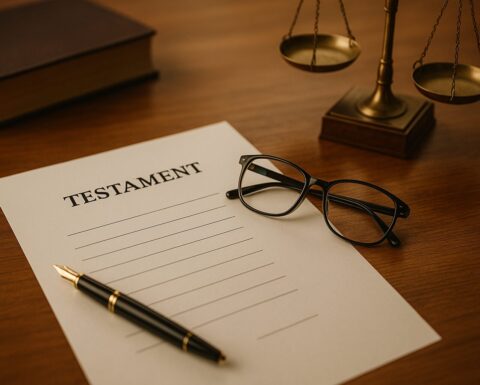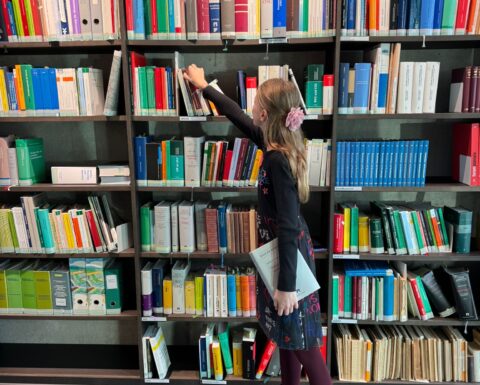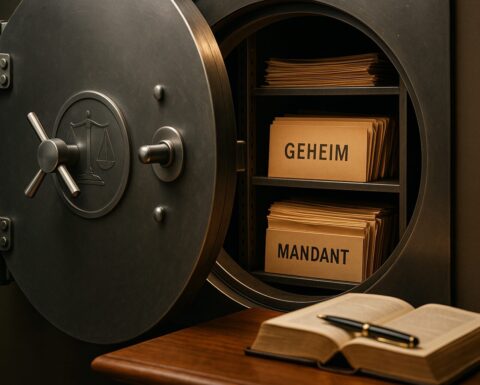Bundesgericht bestätigt bestehende Praxis beim Konkurrenzverbot

Das Bundesgericht entschied im Urteil 4A_5/2025 vom 26. Juni 2025, dass ein nachvertragliches Konkurrenzverbot trotz fehlender ausdrücklicher räumlicher Begrenzung gültig sein kann – sofern sich diese aus dem tatsächlichen Vertragsverhältnis ergibt. Ebenso bekräftigte das Bundesgericht seine bisherige Haltung zur einseitigen Kündigungsmöglichkeit solcher Verbote: Eine einseitige Aufhebung durch den Arbeitgeber ohne entsprechende vertragliche Abrede bleibt unzulässig. Ohne anderslautende vertragliche Abmachung bleibt auch der Arbeitgeber an die Konkurenzverbotsklausel gebunden und muss bei vertraglich vereinbarter Karrenzentschädigung diese dem Arbeitnehmer ausrichten. Schliesslich präzisiert das Bundesgericht, dass erzieltes Ersatz- oder Arbeitslosengeld bei der Karenzentschädigung nicht automatisch anrechenbar ist.
1. Gültigkeit des Konkurrenzverbots trotz fehlender Ortsangabe
- Erstinstanz: Annahme, das Verbot sei ungültig, da keine räumliche Begrenzung enthalten sei – der Arbeitgeber sei international tätig.
- Obergericht Zürich: Konter: Die Arbeitgeberin ist eine schweizerische Ländergesellschaft; daher könne das Verbot auf die Schweiz begrenzt verstanden werden; der Wortlaut und der Kontext stützten diese Auslegung.
- Bundesgericht: Unterstützte diese Schlussfolgerung als «nicht unhaltbar». Die Arbeitgeberin habe nicht überzeugend dargelegt, weshalb eine grössere oder kleinere räumliche Ausdehnung gelten solle. Somit sei das Verbot in zeitlicher, räumlicher und sachlicher Hinsicht angemessen begrenzt und rechtsgültig.
2. Kein einseitiges Kündigungsrecht ohne Abrede
- Bisherige Praxis: Das Konkurrenzverbot mit Karenzentschädigung ist ein zweiseitiger Vertrag; der Arbeitgeber kann ihm nicht einseitig entkommen, ohne eine entsprechende vertragliche Regelung.
- Lehre: Einige Stimmen fordern einen Wechsel der Praxis, zugunsten eines einseitigen Verzichtsrechts – jedoch ohne Karenzentschädigung.
- Bundesgericht: Lehnte eine Änderung ab – keine ausreichenden sachlichen Gründe für eine Abkehr von der langjährigen Rechtsprechung.
3. Ersatzeinkünfte und Karenzentschädigung
- Streitpunkt: Muss der Arbeitnehmer erzieltes Einkommen (z. B. Arbeitslosengeld) auf die Karenzentschädigung angerechnet erhalten?
- Bundesgericht: Klärt, dass Karenzentschädigung keine Schadenersatzleistung ist, sondern die Gegenleistung für Wettbewerbsverzicht darstellt. Sie wird unabhängig davon geschuldet, ob der Arbeitnehmer während der Karenzzeit anderweitig Einkommen erzielt. Eine Anrechnung ist nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung möglich.
4. Bedeutung für die arbeitsrechtliche Praxis
- Vertragsgestaltung: Arbeitgeber können auch ohne explizite Ortsangabe ein gültiges Konkurrenzverbot schaffen – sofern sich die räumliche Begrenzung vernünftigerweise aus dem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ergibt.
- Sicherheit für Arbeitnehmende: Ein einseitiger Rückzug des Arbeitgebers aus dem Konkurrenzverbot ist ohne ausdrückliche Regelung nicht möglich.
- Klare finanzielle Verhältnisse: Die Karenzentschädigung bleibt unabhängig von zusätzlichem Einkommen – also planungs- und einkommenssicher.
- Vorsicht ist geboten: Potentielle Unsicherheiten – etwa, wenn die räumliche Reichweite nicht eindeutig ist – sollten möglichst vertraglich geklärt sein.
Fazit
Mit dem Urteil 4A_5/2025 vom 26. Juni 2025 stärkt das Bundesgericht die Rechtssicherheit: Ein einseitiger Verzicht auf das Konkurrenzverbot durch den Arbeitgeber ohne Abrede bleibt ausgeschlossen – womit die Karenzentschädigung geschuldet bleibt, sofern keine gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde. Der Entscheid zeigt, dass es sich lohnt, der Formulierung eines Konkurrenzverbot genüngende Beachtung zu schenken. Gerne unsterstützen wir Sie hierbei.